Spiegelungen
15.01.2026
Das Neue Jahr ist noch nicht alt, unsere guten Vorsätze haben vielleicht dennoch bereits Mühe, den Stürmen dieser Tage entgegenzuhalten. Global zeigt sich unser Menschsein in vieler Hinsicht auf unheilsame Weise. Es scheint, als ob nach kurzem festtäglichen Innehalten vom „Vergessen des Selbst mit dem Ergebnis des Hervorkommens der 10 000 Dinge“ keine Rede sein kann.
Der vietnamesische Zen Meister Thich Nhat Hanh lehrte unter seinen zahlreichen Übungen der Praxis im Alltag auch eine Spiegelmeditation.
Spiegel sind gute Lehrer, sie können tiefere psychologische Muster an die Oberfläche befördern. Unsere Wahrnehmung könnte sein: negativ, positiv oder neutral. Minderwertigkeit, Arroganz, augenscheinlicher Gleichmut. Verachtung, Übersteigerung, Ignoranz meines Ich. Alle drei führen direkt zu mehr Leiden.
Kann es mir gelingen, beim Blick in den Spiegel zu lesen, wie es mir gerade geht, um meine Handlungen und Auswirkungen dementsprechend auszurichten? So, wie ich an einem Kalligrafiestrich oder dem Klang meiner Schritte erkenne, in welcher körperlichen oder seelischen Verfassung ich mich gerade befinde?
Es wäre doch eine praktische Alltagshilfe. Wir handeln so oft in Unkenntnis unseres aktuellen Zustandes einfach darauf los und teilen reflexartig aus. Zudem: Spiegel gibt es überall. Was lehne ich beim Blick in den Spiegel ab? Was möchte ich gerne sehen und was glaube ich, nicht zu sehen? Was ist so hässlich an meiner Neurose, meiner Biografie? Kenne ich mich? Erkenne ich mich in diesem Bild wieder und was sehe ich? Wieso kann ich mich nicht spontan freuen, wenn ich in einen Spiegel schaue? Schließlich bedeutet das: ich bin noch hier! Was muss beständig gepudert oder retuschiert werden? Warum?
Nun werden die Shunyata-Strebenden bestimmt fragen, wieso wir im Zen, heute bildlich, natürlich auch im übertragenen Sinn, unser Spiegelbild ansehen sollen, wenn es darum geht, mein Selbst zu vergessen.
Weil wir ohne unsere Bereitschaft, eine verwandtschaftliche Verbindung zu jenem Gesicht einzugehen, das uns morgens entgegenblickt, es niemals schaffen werden, es zu vergessen.
„Gatha für den Blick in den Spiegel: Achtsamkeit ist ein Spiegel, der die vier Elemente reflektiert. Schönheit ist ein Herz, das Liebe schenkt, und ein Geist, der weit offen ist.“
Thich Nhat Hanh
Der vietnamesische Zen Meister Thich Nhat Hanh lehrte unter seinen zahlreichen Übungen der Praxis im Alltag auch eine Spiegelmeditation.
Spiegel sind gute Lehrer, sie können tiefere psychologische Muster an die Oberfläche befördern. Unsere Wahrnehmung könnte sein: negativ, positiv oder neutral. Minderwertigkeit, Arroganz, augenscheinlicher Gleichmut. Verachtung, Übersteigerung, Ignoranz meines Ich. Alle drei führen direkt zu mehr Leiden.
Kann es mir gelingen, beim Blick in den Spiegel zu lesen, wie es mir gerade geht, um meine Handlungen und Auswirkungen dementsprechend auszurichten? So, wie ich an einem Kalligrafiestrich oder dem Klang meiner Schritte erkenne, in welcher körperlichen oder seelischen Verfassung ich mich gerade befinde?
Es wäre doch eine praktische Alltagshilfe. Wir handeln so oft in Unkenntnis unseres aktuellen Zustandes einfach darauf los und teilen reflexartig aus. Zudem: Spiegel gibt es überall. Was lehne ich beim Blick in den Spiegel ab? Was möchte ich gerne sehen und was glaube ich, nicht zu sehen? Was ist so hässlich an meiner Neurose, meiner Biografie? Kenne ich mich? Erkenne ich mich in diesem Bild wieder und was sehe ich? Wieso kann ich mich nicht spontan freuen, wenn ich in einen Spiegel schaue? Schließlich bedeutet das: ich bin noch hier! Was muss beständig gepudert oder retuschiert werden? Warum?
Nun werden die Shunyata-Strebenden bestimmt fragen, wieso wir im Zen, heute bildlich, natürlich auch im übertragenen Sinn, unser Spiegelbild ansehen sollen, wenn es darum geht, mein Selbst zu vergessen.
Weil wir ohne unsere Bereitschaft, eine verwandtschaftliche Verbindung zu jenem Gesicht einzugehen, das uns morgens entgegenblickt, es niemals schaffen werden, es zu vergessen.
„Gatha für den Blick in den Spiegel: Achtsamkeit ist ein Spiegel, der die vier Elemente reflektiert. Schönheit ist ein Herz, das Liebe schenkt, und ein Geist, der weit offen ist.“
Thich Nhat Hanh
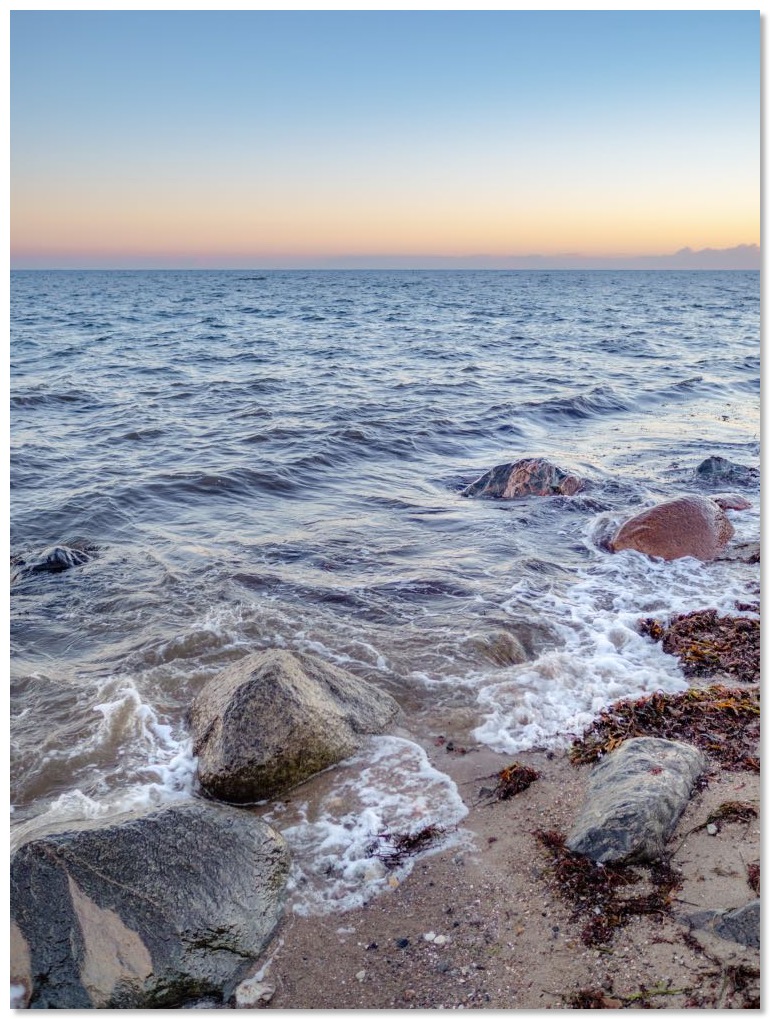
zur Jahresneige
28.12.2025
...möchten wir uns bei allen bedanken, die in diesem Jahr in Musanji, online oder bei den Kursen teilgenommen und so unser Miteinander in der Übung bestärkt haben!
Ferner möchten wir auf ein Kursangebot im schönen Felsentor hinweisen, das wie kein anderes unsere Praxis zusammenfassen wird: https://www.felsentor.ch/seminare/das-fuersorgende-herz-2026
Und letztlich möchten wir einen Artikel teilen, der unsere Arbeit und Praxis veranschaulicht: https://taz.de/Palliativmedizinerin-uebers-Sterben/!6134551/
Die Termine für das Jahr 2026 findet ihr im online-Kalender.
Ferner möchten wir auf ein Kursangebot im schönen Felsentor hinweisen, das wie kein anderes unsere Praxis zusammenfassen wird: https://www.felsentor.ch/seminare/das-fuersorgende-herz-2026
Und letztlich möchten wir einen Artikel teilen, der unsere Arbeit und Praxis veranschaulicht: https://taz.de/Palliativmedizinerin-uebers-Sterben/!6134551/
Die Termine für das Jahr 2026 findet ihr im online-Kalender.

Jahresabschluss in Musanji
20.12.2025
Wir erfreuten uns eines sehr gut besuchten Sanghatages im Dezember und möchten uns bei allen herzlich bedanken, die teilweise weite Wege zu uns gefahren sind.
Im Rahmen des Vortrags haben wir unser Thema "Körper" nunmehr beendet.
Darüberhinaus zeigte dieser Tag einmal mehr, was Sangha ist: Zusammenhalt, Freude an der Gemeinschaft, Solidarität, Verbundenheit in unserer Praxis, wortlos und wortreich. Und tatenreich, wie man sieht...
Dankeschön und auf ein Wiedersehen in 2026!
Im Rahmen des Vortrags haben wir unser Thema "Körper" nunmehr beendet.
Darüberhinaus zeigte dieser Tag einmal mehr, was Sangha ist: Zusammenhalt, Freude an der Gemeinschaft, Solidarität, Verbundenheit in unserer Praxis, wortlos und wortreich. Und tatenreich, wie man sieht...
Dankeschön und auf ein Wiedersehen in 2026!


Über eine Zenreise gen Süden
19.12.2025
Unsere Winterreise führte uns erneut nach Zürich, die mit einem Treffen unter Dharmafreunden über den Dächern dieser schönen Stadt ihren Anfang nahm. Man sieht sich nicht oft und ist doch sofort zusammen: Dharmafreundschaften sind so wichtig wie Zazen.
Einer Einladung folgend, hielt Juen an der ETH Zürich eine Vorlesung an der Fakultät der Philosophie; das Semester beschäftigte sich thematisch mit Ethik am Lebensbeginn und -ende. Dann ging es weiter nach Sentiberg / Felsentor. Wir hatten im September über die entstehende Gemeinschaft etwas unterhalb des Felsentors berichtet. Erneut durften wir in dem schönen Zendo am Bächli, einer ehemaligen Käserei, zusammen sitzen. Als wir, erstmalig an diesem Ort, das HerzSutra anstimmten, wurde noch deutlicher, was eine gemeinsame Praxis auch beim Betreten von Neuland vermag: Möglichkeiten eröffnen, Zuversicht schaffen, Raum geben. Wiederum war der Ort geprägt durch eine beeindruckende Energie, die spürbar war für etwas, das noch nicht sichtbar ist.
Natürlich durfte ein Besuch des Felsentors nicht fehlen, das im winterlichen Licht über dem Seenebel schwebte: filigran, von Alters her, schier unbiegsam durch sein dem ersten Blick verstecktes Zendo im hinteren Garten.
Einer Einladung folgend, hielt Juen an der ETH Zürich eine Vorlesung an der Fakultät der Philosophie; das Semester beschäftigte sich thematisch mit Ethik am Lebensbeginn und -ende. Dann ging es weiter nach Sentiberg / Felsentor. Wir hatten im September über die entstehende Gemeinschaft etwas unterhalb des Felsentors berichtet. Erneut durften wir in dem schönen Zendo am Bächli, einer ehemaligen Käserei, zusammen sitzen. Als wir, erstmalig an diesem Ort, das HerzSutra anstimmten, wurde noch deutlicher, was eine gemeinsame Praxis auch beim Betreten von Neuland vermag: Möglichkeiten eröffnen, Zuversicht schaffen, Raum geben. Wiederum war der Ort geprägt durch eine beeindruckende Energie, die spürbar war für etwas, das noch nicht sichtbar ist.
Natürlich durfte ein Besuch des Felsentors nicht fehlen, das im winterlichen Licht über dem Seenebel schwebte: filigran, von Alters her, schier unbiegsam durch sein dem ersten Blick verstecktes Zendo im hinteren Garten.


